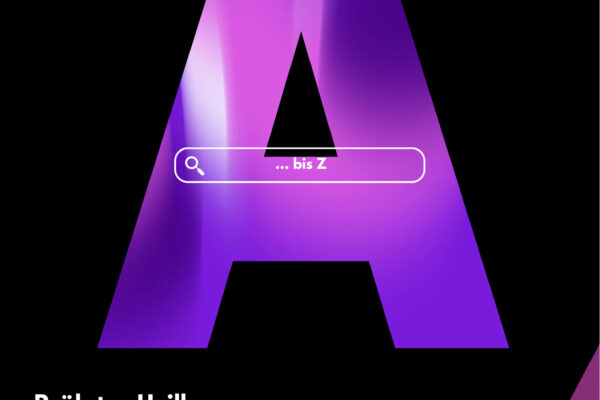Leitsatz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Wir bauen Gemeinden. Die evangelische Kirche ist offen für neue Formen, gemeinsam christlichen Glauben zu leben. Gemeinden werden bunter und vielfältiger; die geistlichen Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen unterschiedlicher. Die Nähe zu den Menschen bleibt für die kirchliche Arbeit vor Ort grundlegend. Gut ausgebildete Pfarrerinnen und Pfarrer und beruflich Mitarbeitende sind und bleiben dafür unverzichtbar. Es braucht starke Netzwerke, in denen Gemeinden regional eng und örtlich angepasst zusammenarbeiten. Der Wohnort wird aber zukünftig nicht mehr das einzige Kriterium für die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde sein. Traditionelle „Zielgruppenarbeit“ wird sich weiterhin wandeln und öffnen. Gemeinde als Sammlung um Wort und Sakrament soll dort eine geistliche Heimat bilden, wo Menschen zusammenkommen.
Meine Gedanken
1) Gesichtspunkte
„Auf diesen Felsen will ICH meine Gemeinde bauen“ (Jesus in Matth 16,18).
Nicht wir bauen. Wir sind Bausteine, lebendige Steine, eingebaut in Gottes Bau. Das rückt alles andere ins richtige Licht und bewahrt uns vor Geschäftigkeit oder Bequemlichkeit, Aktionismus oder Fatalismus.
Desweiteren ist die Gemeinde zunächst keine „Verwaltungseinheit“, sondern ein geistlicher „Organismus“ – Leitbild dafür die von Paulus gefundene Entsprechung „Körper des Christus“, „Leib Christi“. Dahinter steckt ein Doppeltes: zum einen die unmittelbare, genaue, geschenkte Identifikation des lebendigen Jesus Christus mit seiner Gemeinde – sein Körper. Er ist „Christus als Gemeinde existierend“ – sie ist sein Leib.
Und zum anderen die unterschiedlichen Organismen und Funktionen, die so jeweils anders sind wie Tag und Nacht, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Saat und Ernte – und dennoch und gerade deswegen EIN Leib und EIN Segen. Durch Christus – Kopf und Mitte, werden sie zusammengehalten und bekommen ihren Sinn und ihr Miteinander – als Auge und Ohr, Hand und Fuß bei aller Unterschiedlichkeit. Und so ergänzen sich dann diese unterschiedlichen Dimensionen von Zeugnis und Diakonie, Feier und Gemeinschaft, Bildung und Seelsorge.
Dieser Leib ist zugleich schon per se auch auf alle Fälle eine reale und nicht nur eine „spirituelle“ Größe. In der konkreten verfassten ev. Landeskirche z.B. in Württemberg lebt er sich aus – in, mit und unter den vorläufigen und gemischten Bedingungen einer solchen konkreten Verwaltungsorganisation und Dienstgemeinschaft. Ihre Form ändert sich ständig und folgerichtig, um immer wieder miteinander zu überlegen, wie diese Kirche ihrem Auftrag am besten nachkommt. Ortsstrukturen, Finanzierungsmodelle, Immobilien, Personal – all das steht immer wieder auf dem Prüfstand, ohne deshalb sich als eigenes Thema vor den Auftrag hin zu platzieren – es hat immer dienende Funktion. Die großen Trends der Zeit üben genau den hilfreichen Druck auf die Kirche aus, ihre Form immer neu in Frage zu stellen und anzupassen, ohne ihren eigentlichen inneren Inhalt, die Grundlage von Schrift und Bekennen dazu, aufzugeben.
2) Folgerungen
Was aber gibt es dann jetzt zu tun?
a) Ressourcen nutzen
Parochie, Pfarrdienst, ehrenamtlich Hochverbundene, Ortsnähe, …
Man kann, wenn man will, lange den Abgesang singen, oder schlicht und einfach mal das „noch“ streichen und die Ressourcen, wo immer sie zu greifen sind, fröhlich nutzen.
b) Keine heiligen Kühe
Im Blick auf die konkrete verfasste Gestalt von Landeskirche sind manche Entwicklungen an einem Ende angekommen – besonders wenn es um bestimmte Bereiche des vereinskirchlichen Ortsarbeit geht und die lange Zeit ausgebauten stellvertretenden Sonderdienste traditioneller Art. Anstatt sie verzweifelt mit viel Geld zu reanimieren, gilt es mutig alte Zöpfe abzuschneiden; und denen, die an ihnen hängen, neue Perspektiven zu eröffnen, wie zukünftig kirchliche Entwicklungen aussehen können.
c) Den erschöpfenden Aktionismus stoppen
Programm um Programm wurde und wird aufgelegt, das mit viel Personal- und Zeitaufwand den Rückbau von Kirche stoppen soll, der doch zur Hälfte etwa dem demografischen Wandel geschuldet ist
d) Das jetzt miteinander Entdeckte mutig tun
Einige wenige Stichworte können hier genügen: seelsorgerliche Begegnung auf Zeit, die überzeugt den Glauben an Jesus Christus ins Gespräch einbringt, gerade auch bei Kasualien wie Taufe, Konfirmation, Trauung, Bestattung. Hybride Veranstaltungs- und Verkündigungsformen, die den digitalen Raum mit ins Spiel bringen (innovativ und geduldig und ausdauernd), ohne die Präsenz aus den Augen zu verlieren. Öffentliches Nutzen der öffentlich eingeräumten und staatlich garantierten Plattformen und Flächen – wie KiTa und Religionsunterricht positional besetzen ohne jeden Fanatismus, aber mit Leidenschaft.
Und viele weitere Aspekte können hier gemeinsam entwickelt werden – den Ideen ist keine Grenze gesetzt, nur die der Arbeitskraft. Startup-Mentalität ist gewünscht, denn gerade wir leben ja von Fehler und Vergebung.
e) Überzeugter, jünger und internationaler- und ja, auch kleiner und weniger
Kirchliche Entwicklung führt konsequent wie alles in unserer Gesellschaft von der Tradition hin zur Überzeugung – und die Globalisierung tut auch in Zukunft in Württemberg und sonst ihr Übriges, wenn denn wahrgenommen wird, mit wem wir in der Region und vor Ort unterwegs sind und das Miteinander konsequent genutzt wird. Junge Leute von heute sind hier und jetzt schon diejenigen, die uns zeigen können, wie Kirche sich weiter entwickelt. Sie gilt es jetzt zu beteiligen, nicht erst irgendwann. Dabei sind weniger Overhead, weniger Finanzen, wenigergenutzte Immobilien etc. nicht das Aus dieser Art von Kirche, sondern eine Art Tempomacher, solche Kooperationen, solchen Rückbau, solches Zusammenwachsen zu fördern, ohne das Netz der Begegnungsmöglichkeiten des Einzelnen mit dem Evangelium auszuhöhlen.
f) Vertrauen als Beschleuniger
Schon immer war nicht vorhersehbar, welche Formen von Kirche vor Ort und in der Fläche eines Landes jeweils in welcher Generation werden. Das ist auch nicht weiter tragisch, da der Kern kirchlicher Arbeit an anderer Stelle liegt. Muster und Formen ändern sich – nicht aber die Tatsache, dass das Evangelium aufrichtig verkündigt wird und die Formen sichtbarer Lebensgemeinschaft der Kirche, nämlich Taufe und Abendmahl, miteinander gefeiert werden und im Konsens vereinbart, festgelegt ist und auch so gelebt wird, in welcher Art dies geschieht. Dass Christus so Menschen zusammen bringt und sie trotz aller Unterschiede auf ihn vertrauen und deshalb auch einander – das ist die Grundlage. So nehmen sie einander an – weil sie angenommen sind. Vertrauen ist das gemeinsame Kapital. Das wirkt – nach innen. Und das überzeugt – nach außen.
Gedanken der EKD
Unsere Gesellschaft wird immer individualisierter, aber die Sehnsucht nach Gemeinschaft bleibt. Die Bindekräfte traditioneller Organisationen nehmen ab, neue Formen müssen gefunden werden. Viele Menschen haben hohe Ansprüche, wie sie ihr Leben gestalten. Sie suchen in ihrer Freizeit das besondere, außeralltägliche Erlebnis. Für die evangelische Kirche stellt sich aufs Neue die Herausforderung, Menschen zu erreichen und dabei Milieus, soziale Schichten, Geschlechter und Altersgruppen zu übergreifen. Der kirchlichen Bildungsarbeit mit Kindern, Konfirmanden, Jugendlichen und Familien kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Evangelische Schulen, Kitas und Familienbildungsstätten, wie auch Schulseelsorge, Religionsunterricht und diakonische Dienste im Sozialraum verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Zugleich wächst die kritische Auseinandersetzung mit anderen, zum Teil neuen religiösen Gemeinschaften und fundamentalistischen Gruppen. Das bietet die Chance, neu auszuprobieren, wie wir das geistliche Zusammenleben in und mit der Kirche alltagstauglich weiterentwickeln können – so, wie dies an immer mehr Orten in „Fresh Expressions of Church“ geschieht.
Wir wollen auf die Herausforderungen einer sich verändernden Gesellschaft reagieren. Die Analyse des gesellschaftlichen Umfelds und aller kirchlichen Aktivitäten sehen wir als wichtiges strategisches Mittel der Kirchenentwicklung und stärken sie institutionell. Strukturen müssen sich verändern, wenn sie keine Relevanz und Resonanz mehr ermöglichen. Netzwerke schaffen Entlastung und Freiräume. Nicht mehr jeder muss alles machen. Dies lässt sich nicht zuletzt am Wandel des Berufsbildes von Pfarrerinnen und Pfarrern ablesen. Wir werden manches aufgeben, aber wir wagen auch Neues und erhalten Bewährtes.
Geistliche Gemeinschaft und Weitergabe des Evangeliums geschieht in Form persönlicher Beziehungen. Ortsgemeinden stehen wie alle anderen kirchlichen Einrichtungen vor der Herausforderung, kirchlich Hochverbundenen Heimat zu bieten und gleichzeitig neue Kontaktflächen für Menschen zu eröffnen, die bisher wenig mit Kirche zu tun haben. Dieser Aufgabe werden sie umso besser gerecht, je mehr sie sich als Teil eines regionalen, ortsübergreifenden Netzwerkes verstehen, in dem sich die verschiedenen Akteure gabenorientiert und klug aufeinander beziehen. Sie konzentrieren sich auf das, was sie am besten können, und überlassen anderes denen, die dies besser machen. Viele gelingende Beispiele zeigen schon jetzt, dass ein solches Selbstverständnis entlastende Wirkung hat und den der Kirche aufgetragenen Dienst stärkt. Von dieser Einsicht ausgehend haben wir begonnen, neue Formen von Gemeinde und Gemeinschaft zu erproben. Organisatorisch ist für die „Kirche im Dorf“ und die Gemeinde im städtischen „Quartier“ bereits ein Wandel eingeleitet. Starke und handlungsfähige ortsbezogene Gemeinden (Parochien) werden in Zukunft ebenso eine zentrale Rolle spielen wie inzwischen bewährte regionale Gemeindeverbünde oder Formen guter Zusammenarbeit von gemeindlichen und übergemeindlichen Diensten.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der jungen Generation. Sie soll in Zukunft verbindlicher in Reformprozesse einbezogen werden; wir setzen darauf, dass junge Menschen mehr Verantwortung übernehmen. Das ist vor allem für eine Generation wichtig, in der die familiäre Weitergabe des Glaubens wegbricht.
Die Kirche wird flexibler und an wechselnden Orten präsent sein. Kasualien und christliche Lebensbegleitung werden vielfältiger und individueller. Wir probieren mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen neue, der jeweiligen Situation und den örtlichen Bedingungen angepasste Formen der Versammlung um Wort und Sakrament aus. Hierfür werden zusätzliche Ressourcen bereitgestellt. Das Gottesdienstangebot wird insgesamt kleiner und sollte deswegen gemeindeübergreifend besser abgestimmt werden. Es wird zunehmend durch alternative gottesdienstliche Feiern und Formen spiritueller Gemeinschaft an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten bereichert. Sie ergänzen schon jetzt den traditionellen Sonntagsgottesdienst. Dies muss bei der Statistik des Gottesdienstbesuchs berücksichtigt werden, um Entwicklungen besser zu erkennen und darauf zu reagieren.