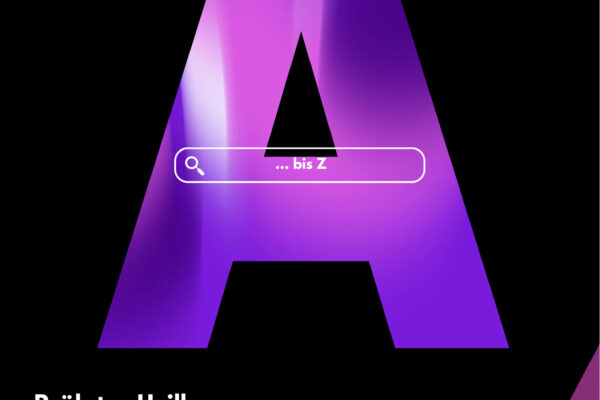Leitsatz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Wir entscheiden verantwortlich. Die evangelische Kirche braucht zur Umsetzung der Reformen eine bessere interne Abstimmung und den Willen zur Zusammenarbeit. Es wird häufiger Entscheidungen geben, bei denen es nicht allen recht gemacht werden kann. Wir müssen mit Blick auf die Zukunft der gesamten Kirche Prioritäten setzen. Unser Ziel sind Rahmenbedingungen, in denen die Kirche mit ihrer Botschaft klar erkennbar und handlungsfähig bleibt. Wir setzen uns dafür ein, dass Missbrauch von Vertrauen und Macht durch Prävention und strukturelle Maßnahmen verhindert werden, und sorgen für eine angemessene Aufarbeitung.
Meine Gedanken
1) Gesichtspunkte
„Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift“ (1. Korinther 15,3-5). Darum geht es bei Leitung, leitend immer wieder dienend zum Wesentlichen hin zu leiten. Das Wesentliche ist eine Person. Das Wesentliche ist die Hauptsache. Das Wesentliche ist das/der, wovon wir leben. Der Wesentliche ist für uns Vorgabe und Verheißung, Zusage und umfassender Auftrag.
Was hindert uns aber daran, zum Wesentlichen zu kommen? Unser Aktionismus, unsere fehlenden Prioritäten und (Jahres-)Ziele, unser Sich-Verlieren in den Kleinigkeiten des Alltags. Leitung identifiziert diese Hemmer und geht dagegen an.
Was hilft uns dabei, zum Wesentlichen zu kommen? Diesem „empfangenen“ und „weitergegebenen“ Wort auch Priorität einräumen. Immer wieder fragen: „Was würde Jesus dazu sagen?“ – eine einfache, aber wirkungsvolle Frage. Und es gibt auch einige ganz einfache Leitungsprinzipien, die helfen, die Dinge leitend gut zu bewältigen: Alltagsgeschäft offen und nachvollziehbar delegieren (Ausschüsse, Teams, Gruppen). Der geistliche Rahmen, der geistliche Beginn mit Wort und Gebet richtet alles aus. Der Rest der Arbeit ist ebenfalls ein eminent geistlicher, kein zweitklassiger, aber eben ein anderer, ein delegierter. Entscheidende Skills dafür sind Konzentration, Kooperation, Delegation. Das Delegierte und dann auch Erledigte wertschätzen, Rückmeldungen einholen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten. Und auch in diesem Leiten braucht auf jeden Fall immer die Zeiten des Empfangens und Segens.
2) Folgerungen
Was aber gibt es dann jetzt zu tun?
a) Kooperation
Für alles, was wir tun, sind wir im Team besser als alleine. Mehr Gaben, mehr Möglichkeiten, mehr Ideen, mehr Bedenken. Wir suchen Verbündete – wir bauen Brücken, keine Gräben. Immer einmal ist es dabei nötig, schnell und beinahe spontan eine kleine Gruppe zu „gründen“, um eine Idee, ein Problem, eine Frage miteinander kreativ zu bearbeiten.
b) Innovation
Wir denken über das Vorfindliche hinaus. „Out of the box“, außerhalb des vorgefertigten Rahmens liegen die Möglichkeiten, die uns entscheidend weiterbringen. Wir rechnen ja nicht nur mit den eigenen Ressourcen, sondern mit Gottes Geist. Das ermöglicht, dass neue Wege beschritten werden, wo eigentlich gar kein Weg sichtbar ist. Diese Form der Innovation ist äußerst entlastend, weil wir nicht auf uns selbst zurück geworfen sind und auf „Teufel komm raus“ irgendwie zwanghaft und mit vollem Elan, der uns überfordert, spritzig sein müssen. Die Innovation steckt im Kern unserer geistlichen DNA, dieses Wort und dieser Geist sind „neu“, schaffen Neues, stecken uns an.
c) Diskussion
Konflikte und Schwierigkeiten sind das Salz in der Suppe – und verlangen danach, behutsam und deeskalierend angesprochen zu werden. Damit ist klar: Störungen Vorrang einräumen und selbstkritisch benennen. Sich selbst auch zurück stellen können und einen dienenden Ort einnehmen.
d) Delegation
Schon ganz am Anfang hat die christliche Gemeinde Aufgaben delegiert. Das war die Lösung, als Witwen bei der Essensausgabe übersehen wurden. Wort und Gebet an der einen Stelle, Personal- und Ressourcensuche an der anderen Stelle (Apostelgeschichte 6,4). Die verschiedenen Aufgaben und Berufsgruppen haben einander ergänzt – und tun es bis heute. Je eigene Profile und das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt – wertschätzend und gabenorientiert – das hilft und beflügelt.
e) Konzentration und Konsens
Der Heilige Geist leitet Menschen zueinander – und gerade im Konsens und Kompromiss, der nicht faul ist, liegt eine entscheidende Leitungsfähigkeit. Menschen miteinander so zu moderieren, dass sie gemeinsam einen Weg nach vorne finden und diesen auch abgestimmt gehen, ist eine entscheidende Kunst. Dabei geht es nicht um irgendeine nicht mehr beschriebbare Mitte, sondern im Gegenteil darum, dass wir uns immer wieder auf das Entscheidende, Wesentliche konzentrieren und Randfragen auch als solche identifizieren.
f) Geistlich leiten
Neben allen Skills, die wir miteinander zur Leitung brauchen, liegt das Wesentliche der Leitung in der Besonderheit des geistlichen Leitens. Leiten durch Verkündigung und gestaltgewinnende Theologie, die immer wieder eingebracht wird und unser gemeinsames Handeln trägt und begründet und motivierend und korrigierend begleitet. Andacht und Gebet, Stille und Ruhe, Meditation und Nachfrage, Wahrnehmen und Stehenlassenkönnen – all das zeichnet geistliche Leitung aus. Die dienende Haltung, das diakonische Leiten findet hier entscheidenden Niederschlag. Und geistliche Leitung lebt aus der Vergebung und kann deshalb sowohl Fehler machen als auch Fehler benennen, eigene Defizite wahrnehmen und sich selbst als ergänzungsbedürftig erkennen. Wir merken, dass wir auf keinen Fall bereits alles mitbringen, was nötig ist – im Gegenteil: Leitung braucht andere lebensnotwendig.
Diese Form der Leitung hat ein Ziel: nämlich, dass alle Menschen, mit denen wir zusammen sind, im Kontakt mit uns einen Impuls empfangen oder uns geben, der durch diese Begegnung und gemeinsame Arbeit etc. bewirkt, dass wir glauben, hoffen, lieben. Mehr und mehr – im qualitativen Sinn. Also mehr Bedürftigkeit, mehr Versöhnung, mehr Eingeständnis des Fragments, mehr Angewiesensein auf Gott, mehr Überzeugung, mehr Geduld, mehr Durchhaltenkönnen, mehr Jesus.
Gedanken der EKD
Für ein Zusammenleben in Vielfalt ist es notwendig, gemeinsam zu formulieren, was es heißt, auf der Grundlage des Priestertums aller Getauften „Evangelisch Kirche zu gestalten“. Grundlage für alle Entscheidungen bleiben Christusbindung, Geistverheißung und Liebesgebot, die wir in reformatorisch-protestantischer Vielfalt des Leibes Christi leben. Wir wollen sie aber in einem stärker erkennbaren Gemeinschaftssinn umsetzen. Unsere Leitungskultur soll auf allen Ebenen darauf ausgerichtet sein, gelingende Gemeinschaft in der Pluralität zu eröffnen. Dafür sind diversitäts- und geschlechtssensible Rahmenbedingungen, eine klare Rolle und definierte Aufgaben für alle Verantwortlichen die zentrale Voraussetzung.
Die Herausforderung für kirchliche Leitung besteht darin, ebenenübergreifend in der Vertikalen wie auch horizontal im Zusammenwirken unterschiedlicher Handlungsfelder und Akteure Abstimmung und Konzentration zu ermöglichen. Eine innovationsorientierte, dynamische und verschlankte Organisationsstruktur der Kirche stellt hohe Ansprüche an das gesamtkirchliche Leitungs- und Steuerungshandeln. In zurückliegenden Wohlstandsphasen galt die Ausweitung und Ausdifferenzierung der Angebote als sinnvolle Strategie. Damit dies an sinnvollen Stellen weiterhin möglich bleibt, wird insgesamt die Konzentration und Profilierung kirchlichen Handelns umso dringlicher. Interne Streitigkeiten, nebeneinander agierende und selbstbezügliche Institutionen schwächen durch mangelnde Rückbindung an die Gemeinschaft der Kirche die Erkennbarkeit des Evangeliums.
Zukünftig wird es noch wichtiger, dass Mitarbeitende mit Leitungs- und Führungsaufgaben im Sinn gesamtkirchlicher Orientierung und christlicher Identitätsbildung wirken. Die Leitungs- und Entscheidungskultur im kirchlichen Raum darf den Maßstäben christlicher Gemeinschaftsbildung nicht widersprechen. Angesichts der Wucht der anstehenden Aufgaben können Entscheidungen nicht dem Selbsterhaltungsinteresse von Teilbereichen dienen. Transparenz, Partizipation, Stellvertretung und gute Begleitung sind die Voraussetzung dafür, dass Beteiligte die Prozesse eines freiwilligen Zusammengehens in größere Einheiten und selbstgesteuerte Kooperationen mittragen und mitgestalten können. Die Verantwortlichen sollen sich dabei Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung zum Ziel setzen.
Leitungsgremien stehen vor der Aufgabe, Auswahl- und Priorisierungsentscheidungen zu treffen. Hierfür benötigen sie klare und empirisch gestützte Kriterien sowie ein klares Bild vom Auftrag der Kirche. Der Fokus von Entscheidungen kann nicht mehr den bloßen Erhalt einer Stelle, eines Arbeitsbereichs oder einer Einrichtung betreffen. Wir müssen vielmehr zukunfts- und aufgabenorientierte Lösungen suchen, die auch das Bestehende hinterfragen.
Gefährdung durch Machtmissbrauch und körperliche wie psychische Grenzüberschreitungen fordern kirchliche Leitung heraus. Die evangelische Kirche untersucht die Ursachen von Übergriffen mit Hilfe externer Expertise. Sie fördert Ansätze der Prävention und des strukturellen Gewaltschutzes. Sie entwickelt klare Standards in der Aufarbeitung von Grenzüberschreitungen.