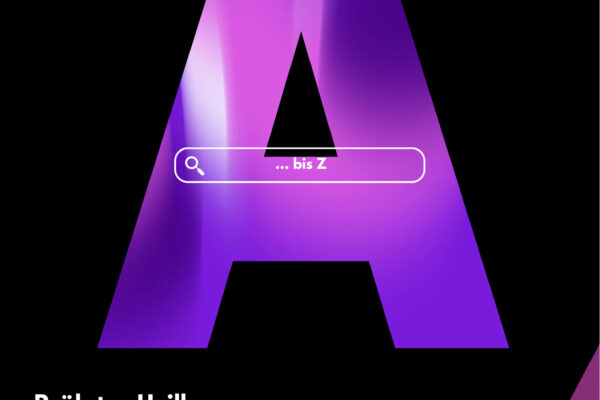Leitsatz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Wir bewegen uns. Die evangelische Kirche wird in Zukunft organisatorisch weniger einer staatsanalogen Behörde, sondern mehr einem innovationsorientierten Unternehmen oder einer handlungsstarken zivilgesellschaftlichen Organisationen ähneln. Die Aufträge für unsere Mitarbeitenden lassen Spielraum, auf Trends zu reagieren. Kirchliche Orte ermöglichen Begegnungen. Damit das funktioniert, arbeitet im Hintergrund eine professionelle, agile und gut ausgestattete Verwaltung, zunehmend nach EKD-weit abgestimmten Standards.
Meine Gedanken
1) Gesichtspunkte
Kirche ist unterwegs. Ist Zelt, das immer wieder abgebaut werden muss und kann – und nicht Prachtbau. Und das deshalb, weil auch das Wort Gottes (Johannes 1,14) unter uns „zeltet“, in diesem Sinne wohnt. Damit ist schon vorgegeben, dass Strukturen veränderlich gehalten sind und es auch sein müssen.
Und zugleich sind Strukturen und Organisation und Ordnungen kein Sündenfall für die Kirche. Im Gegenteil – Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und dazu hilft eine gute, effiziente Verwaltung, dazu helfen geordnete Abläufe und geregelte Verfahren und Gremien. Sie bringen nicht das Heil, aber ohne sie geht auch vieles heillos durcheinander. Wie aber sehen Strukturen aus, die Veränderungen nicht verunmöglichen? Wie schaffen wir Abläufe, die serviceorientiert und schlank das zur Verfügung stellen, was Kirche für Finanzen, Personal, Strukturen, Immobilien etc. braucht?
2) Folgerungen
Was aber gibt es dann jetzt zu tun?
a) Basisorientiert verändern
Macht mir die Gemeinde stark! Dort findet die Königsdisziplin kirchlicher Arbeit ab – und von dieser Basis her Bottom up strukturieren wir Kirche. In den kleineren Einheiten kann sehr schnell und sehr flexibel reagiert werden auf neue Herausforderungen. Dort können neue Ideen erprobt werden, dort kann Neues ausprobiert werden. Was dort befürwortet wird, das wird wirklich nachhaltig breit strukturell akzeptiert.
b) Zusammenführen
Und gerade von dort schauen wir, was wir wirklich dezentral brauchen – und was gemeinsam in Verbänden, Verbünden, Fusionen, Verbundgemeinden etc. getan werden kann. Denn was zu klein und zu unprofessionell und zu wenig vernetzt arbeitet, bleibt hinter dem zurück, was uns dienen kann. Das gilt für die Diakonischen Träger und Aufgaben genau so wie für die Kindertagesstätten und die Chance, dass kleine Kinder mit Gott groß werden und diese KiTas effizient verwaltet und gestaltet werden.
Der Religionsunterricht ist ein weiteres Beispiel, wie gemeinsame Standards und Bildungskompetenz und geistliche Angebote Hand in Hand dafür sorgen können, dass Menschen gut und gerne Unterricht erteilen und den Glauben attraktiv erleben. Im Bereich der Bildung arbeiten wir so gerne zusammen – wie auch erst recht bei Finanzen und Personalverwaltung. Viele, viele gesamtkirchliche Aufgaben können zentral hilfreich und kompetent stellvertretend gestaltet werden.
c) Doppelbeschäftigungen abschaffen
Und selbst in solchen Einheiten kommt es häufig zu Befassungen mit den gleichen Abläufen und Themen, ohne dass man voneinander weiß. Diese Doppelbefassungen zu merken und dann konsequent die Leute miteinander in Kontakt bringen und am Ende delegieren und nicht Unterschiedliche nebeneinander her oder gar gegeneinander mit dem Gleichen zu beschäftigen – das ist ein lohnendes Ziel. Denn es spart Zeit, Geld und Nerven. Die Aufgabenkritik, die damit getan wird, schafft Luft. Und sie geht auch dem nach, wo wir Dinge vereinfachen können, damit gefühlte „Ehrenrunden“ der Beschäftigung entfallen. Und damit Zeit und Frust gespart wird.
d) Digitalisieren
Der Ort, an dem dies effizient und mit einem Potential verwirklicht werden kann, das atemberaubend ist, ist die Digitale Welt. Dort können Termine gemeinsam verwaltet werden, Prozesse miteinander angestoßen und weiter vorangetrieben, Besprechungen gestaltet sowie an gemeinsamen Dokumenten miteinander gearbeitet werden.
Es ist aber noch so unendlich viel mehr möglich – denn Virtualität steuert Realität. Grenzen sind dabei auch denkbar eng zu setzen, wenn es um den Menschen als Verfügungsmasse ginge – anstatt die Würde des Menschen und seine Gottesebenbildlichkeit und seinen Wert in jedem Moment zu schützen.
e) Menschen mitnehmen
Die besten Strukturideen brauchen Leute, die sie aktiv in Breite unterstützen. Denn immer halten wir uns in solchen Prozessen in vier verschiedenen Räumen auf: der Zufriedenheit, der Veränderungsbereitschaft, der Befürchtung und gar Verweigerung und der geschehenden Veränderung bis hin zur neuen Zufriedenheit. Die einzelnen Stimmungslagen in uns selbst, die ändern sich je. Und Menschen halten sich auch durchgehend in unterschiedlichen Räumen auf. Gerade die Bedenkenträger immer wieder zu informieren und mit zu nehmen, ist eine entscheidende Aufgabe rund um Strukturen.
f) Zukunftsorientierte Lösungen
Bei jeder Strukturveränderung braucht es auf dem Weg Zwischenschritte – die Gefahr besteht lediglich darin, einen dieser Zwischenschritte, die zum Teil sehr komplexe Zwischenkonstrukte aushalten müssen, schon zum Endzustand zu deklarieren. Das ist eine Falle, in die wir schnell tappen – deshalb braucht es immer einmal wieder das große strukturelle Zielfoto, auf das wir dann in Schritten zugehen, die in sich je noch komplex genug sind, aber gelingen können, weil wir das große Ganze vor uns sehen.
Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege – so hat Jesus einmal die Ausgangslage der Nachfolge beschrieben, in die sich Kirche und Gemeinde auf dem Weg IHM nach begibt. Nehmen wir das ernst, halten wir uns nicht mehr so unlösbar an immobilen vergänglichen Altstrukturen fest – und erwarten auch von neuen Strukturen nicht das Seelenheil, in dem wir uns jahrelang in PfarrPläne, Immobilienkonzepte und neue Finanzsoftwares etc. verbeißen. Sondern wir erledigen dies auch und gern, weil es uns hilft, das Eigentliche gut zu leben – das Evangelium von Jesus Christus in seinen Dimensionen von Wort, Tat, Feier und Gemeinschaft.
Gedanken der EKD
Die evangelische Kirche in ihrem derzeitigen Erscheinungsbild lässt sich als „Hybrid“ aus Institution, Organisation und Bewegung beschreiben. Alle drei Aspekte sind wichtig, damit die evangelische Kirche in Übereinstimmung mit ihrer Botschaft und der jeweiligen Situation angemessen handelt: In ihrer institutionellen Gestalt gewährleistet die Kirche, dass ihre Angebote verlässlich sind. Hierfür braucht sie stabile Ressourcen und eine gut funktionierende Verwaltung. In ihrer organisatorischen Gestalt entwickelt die Kirche kommunikative Strategien und Beteiligungsmöglichkeiten, auch über ihre institutionellen Grenzen hinaus. Als Bewegung ist sie fähig zu schnellem, flexiblem Vorgehen.
Auch als Organisation und Institution wird die evangelische Kirche wandlungsfähiger und risikobereiter werden. Das muss sich auch in der Gestaltung ihrer Rechtsordnung niederschlagen. Dabei können die traditionell stärkeren und wohlhabenderen evangelischen Kirchen im Westen von der Minderheitensituation im Osten lernen: Kleinere Versammlungen um Wort und Sakrament bedeuten weder Mut- noch Sinnlosigkeit. Sie entlasten auch von erstarrten Routinen und eröffnen die Chance, Neues auszuprobieren. Die sozialen Ausdrucksformen in den vier Grundvollzügen kirchlichen Handelns (martyria, leiturgia, koinonia und diakonia) werden vielfältiger. Parochiale und überparochiale Strukturen werden sich verändern: Ankerpunkt bleiben starke und ausstrahlungsfähige Gemeinden in verschiedenen Formen. Daneben treten sorgfältig abgestimmte und leicht zugängliche Angebote und Initiativen auf regionaler Ebene und im digitalen Raum. Kleine, dezentral vernetzte Gruppen werden mit ihren Aktivitäten herkömmliche Strukturen und Begrenzungen aller Art kreativ infrage stellen.
Wir werden mutiger als bisher zwischen resonanzlosem kirchlichem Handeln und Resonanzräumen unterscheiden müssen: Wo werden Herz und Seele berührt? Wo wird die Präsenz unserer Botschaft in der Gesellschaft spürbar? Und wo nicht? Es gilt, das eine zu lassen, um das andere zu stärken. Ein zentrales Kriterium bei allen Entscheidungen ist, dass die nächste Generation die Chance behält, angstfrei und voller Zuversicht das Evangelium auch mit geringeren Ressourcen weiterzugeben.
Gute kirchliche Verwaltung bemisst sich daran, dass Verantwortlichkeiten und Kompetenzen auf der Ebene der jeweils Handelnden angesiedelt sind. Sie arbeitet verlässlich und transparent, und sorgt für Strukturen, die Machtmissbrauch verhindern und Geschlechtergerechtigkeit fördern. Kirchliche Verwaltungsstrukturen halten Verantwortung, Zuständigkeit und Kompetenz zusammen und ermöglichen ein transparentes und prozessorientiertes Verwaltungshandeln. Die Zahl der Verwaltungsvorgänge und Genehmigungsvorbehalte wird regelmäßig überprüft und wo immer möglich reduziert; dafür soll es mehr Entscheidungsfreiräume geben. Wir wollen schnelle Abstimmungswege, flache Hierarchien und konzentrierte Partizipationsformen ermöglichen. Kirchliche Leitung handelt auf allen Ebenen viel koordinierter und kooperationsbereiter. Kirche sorgt für Verlässlichkeit, Partizipation und Solidarität im Blick auf Verpflichtungen und Aufgaben, die Kirchen als Träger von diakonischen und Bildungseinrichtungen in Ökumene, Staat und Gesellschaft übernommen haben.