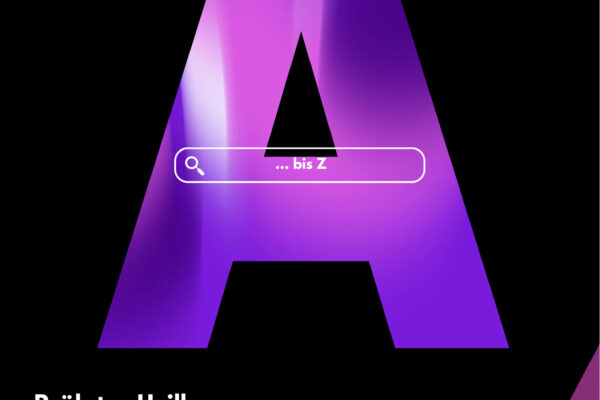Leitsatz der Evangelischen Landeskirche in Deutschland (EKD)
Wir wollen, dass viele Menschen dazugehören. Die evangelische Kirche ermöglicht auch Menschen aktive Teilhabe, die (noch) nicht Kirchenmitglied oder getauft sind. Die Botschaft von Jesus Christus ist eine große Einladung; alle können zur Gemeinde gehören und in ihr mitmachen. Das soll in Zukunft auch nach außen und durch mehr interkulturelle Öffnung noch sichtbarer werden. Die Verbundenheit von Menschen im Berufseinstiegsalter mit der Kirche soll gestärkt werden. Dabei soll neben inhaltlichen Angeboten auch ergebnisoffen über finanzielle Aspekte der Mitgliedschaft nachgedacht werden. Wir wollen Mitbestimmung und aktive Beteiligungsmöglichkeiten in der Gemeinde in dieser Lebensphase stärken.
Meine Gedanken
1) Gesichtspunkte
Die unsichtbare Gemeinde Jesu Christi sehnt sich danach, in unterschiedlichsten sichtbaren Formen Gestalt zu gewinnen, von denen keine die einzig seligmachende ist – es gilt nur eines: „ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum“ – es gibt also kein Alleinsein. Dass gerade die ev. Landeskirche von Württemberg eine wunderbare Form des gemeinsamen kirchlichen Miteinanders in ihrer ganz besonderen Form der lutherischen Grundlagen, der von Pietismus stark geformten Betonung der Augenhöhe des Ehrenamts und der Bibelorientierung des kirchlichen Lebens sowie durch das „Ländle“ geformte ungeheuren Potentiale des Entrepreneurship und Weltmarktführertums – also mit einer unvergleichlichen Innovationskraft und Knitzheit, das hat eben seinen ganz besonderen Charme. Unsere „von Gott geliebte württ. Landeskirche“ ist also meiner Meinung nach weiter die attrakviste Form des Miteinanders in einer vorfindlichen kirchlichen praktischen Gestalt – und ich gehöre sehr gerne und überzeugt dazu – bei aller Offenheit für den Reichtum der ökumenischen innerprotestantischen und weiteren kirchlichen konfessionellen Weite.
Wie aber halten und gewinnen wir Mitglieder – und der Maßgabe, dass es ganz normal ist, dass es Zeiten gibt, in denen auch Organisationen sich umbauen – also Zeiten wie Sommer und Winter im Kreislauf des Lebens. Es gilt zu fragen, was wir dann jeweils konkret tun …
2) Folgerungen
Was aber gibt es dann jetzt zu tun?
a) Das Offensichtliche sehen
Warum treten Menschen aus der ev. Landeskirche aus? Nebst vielen scheinbaren Gründen ist das gesamte Auftreten und die Glaubwürdigkeit von Kirche insgesamt entscheidend. Deshalb gilt es zum Beispiel im Rahmen der Missbrauchsdebatte Anerkennung des Leids, Prävention, Aufarbeitung ohne jede Vertuschung und transparentes, die ‚Ärmsten der Armen schützendes Verhalten ganz intensiv zu befördern. Und immer wieder das Thema so in dee Öffentlichkeit zur Sprache zu bringen, dass Opfern Geerchtigkeit wiederfährt und die vielen Dinge, die im Bereich der ev. Kirche getan werden, bekannt werden und bekannt bleiben.Tue Gutes, tue es wirklich und andauernd, und rede darüber.
b) Keine „billigen“ Lösungen
Die Preise zu senken, wenn die Qualität stimmt, ist kein Weg. Rabatt war schon immer eine, manchmal nicht vermeidbare, Form der Verzweiflung. Und die soziale Komponente ist ja bereits bei der Kirchensteuer vollständig eingetragen. Jetzt geht es eher immer wieder darum zu zeigen, was an Qualität geschieht und dafür zu werben – denn was es wert ist, zeigt sich nicht am weggestrichenen Preis.
c) Vielfalt gemeindlicher Formen zulassen
Reformen gab es schon immer – und immer gingen sie von der Basis aus und wurden nicht von ferne verordnet. Es gilt sie derzeit immer wieder zu ermöglichen und möglichst wenig zu stoppen – vor Ort zu vermitteln im Blik auf die damitz konfrontierten Beharrenden, die ja auch ihre Berechtigung haben (Hand unf Fuß am gleichen Körper also …). Und Freiräume zuzulassen, Erprobungen …
d) Taufoffensive
Taufe und Glaube – darauf steht das Zugehören zu Gemeinde Jesu Christi – zeitliche Reihenfolge offen und nicht nötig festzulegen. Somit gilt es, an tausend verschiedenen Stellen zur Taufe einzuladen. Tauffeste und persönliche Tauffeiern, lioebevoll gestaltete Kasualien in Sonntagsgottesdiensten, Tauferinnerungen und vieles mehr – das gilt es neu zu entdecken und ein Projekt vor Ort immer einmal wieder zu lancieren – besser eines und das gut als viele und dann nicht umgesetzt.
e) Glaubensoffensive
Schon oft genug betont, ist Mission der Pulsschlag gemeinsamen geistlichen Lebens. Und das in aller Vielfalt dessen, was dabei an Formen angesprochen ist. Dies vor Ort und an besonderen Orten wieder und wieder einladend anzubieten und in den persönlichen Lebensbeziehungen ins Gespräch zu bringen, ist Chance und Auftrag im Blick auch auf Mitgliedergewinnung. Denn es geht nicht allein und zuerst um Zahlende, es geht um Mit-Gemeinschafts-Erlebende und Gestaltende – auf ihre jeweils ganz besondete Art. Menschen kommen mit Gott geschenkt und miteinander gestaltend in Verbindung.
f) Diakonische Glaubwürdigkeit
Einander zu dienen, macht Kirche unglaublich attraktiv. Weltweit und vor Ort zu helfen, wo Not am Mann und an der Frau ist, ist direkter, erfahrener Gottesdienst. Hungernde, Gefangene, Unbekleidete, Einsame, Verfolgte, Kranke … – sie alle und noch mehr brauchen Zuwendung und erleben diese als direktes Handeln Gottes. Das macht Kirche erfahrbar und gibt ihr einen direkten Eindruck, etwas an Jesus zu tun und für Gott zu tun.
Kirchenmitgliedschaft kann attraktiver werden. Überzeugter. Mit engerer Bindung. Und auf dem Hintergrund dann auf eine ganz neue Art selbstverständlicher. Daran zu arbeiten gilt es, darauf zu vertrauen und von diesem Vertrauen auf Gott getragen es selbst überzeugt zu sein – Mitglied – das strahlt aus.
Gedanken der EKD
Zum evangelischen Kirchenverständnis gehört, zwischen der Zugehörigkeit zur Kirche als Gemeinschaft aller Getauften und der formalen ‚Mitgliedschaft‘ zu unterscheiden. Die Mitgliedschaft ist die Form der in der Taufe begründeten Gemeinschaft. Sie bleibt an die Taufe gekoppelt. Weil die Taufe für uns der Lebensanker ist, werben wir für sie aus tiefer Überzeugung.
Wir beobachten zugleich, dass auch jenseits von Taufe und Mitgliedschaft Neugierde, Interesse an Kirche und eine vorsichtige Annäherung und Teilnahme zunehmen. Dabei bestehen regional große Unterschiede. Jenseits der Logik der Mitgliedschaft wollen wir neue Formate von Zugehörigkeit entwickeln für Menschen, denen die Kirche wichtig ist, die aber (noch) nicht Mitglied sein wollen oder können. Dazu gehören neue Formen geistlicher Gemeinschaft, aber auch erweiterte Möglichkeiten, kirchliches Engagement für die Gesellschaft zu unterstützen.
Die Taufe ist das Fundament der christlichen Gemeinschaft. Tauferinnerung bietet die Möglichkeit, biographische Anknüpfungspunkte zu finden und Beziehungen zu vertiefen. Die Zahl der Nichtgetauften und der Ausgetretenen nimmt zu. Nach evangelischem Verständnis hat die Kirche für alle diese Menschen Verantwortung. Schon jetzt sind alle, die sich beteiligen möchten, auch ohne Kirchenmitgliedschaft willkommen. Wir möchten mehr Räume eröffnen, in denen sich auch diejenigen heimisch fühlen können, die sich flexibel und auf Zeit beteiligen möchten. Eine Gestaltungsmöglichkeit besteht durch eine besondere Form der sichtbaren Zugehörigkeit, die eine bessere Kommunikation und engere Bindung ermöglicht.
Wer Mitglied ist, identifiziert sich heute bewusster mit der Kirche. Wir fördern systematisch das Engagement und die Verantwortungsübernahme unserer Mitglieder. Kirchenmitglied ist man nicht um persönlicher Vorteile willen. Doch wir wollen Mitgliedstreue dort besonders würdigen, wo Mitglieder kulturelle, soziale und diakonische Leistungen im kirchlichen Bereich in Anspruch nehmen. Wir werden Initiativen zur Mitgliederkommunikation bestärken und die Erreichbarkeit der Kirche verbessern. Gleichzeitig stärken wir den Gedanken der geistlichen Gemeinschaft und gesellschaftlichen Verantwortung. Solidarität und Nächstenliebe motivieren zum Engagement in der Kirche und sind die Basis für kirchliches Engagement in der Welt.
Junge Menschen in der Berufseinstiegsphase treten überdurchschnittlich häufig aus der Kirche aus. Das stellt uns zuallererst vor die Aufgabe, durch bessere Begleitung besonders in dieser Lebensphase die Verwurzelung im Glauben und die Bindung an die Kirche zu stabilisieren. Wir beobachten zugleich einen Zusammenhang von Austrittsverhalten und Kirchensteuer. Junge Menschen müssen nachvollziehen können, welche Aufgaben wir als Kirche wahrnehmen, woher das nötige Geld kommt und welche Mitbestimmungsmöglichkeiten es gibt, vor allem auf die eigene Gemeinde bezogen. Daneben sollen Ideen zur Verbesserung des Kirchensteuersystems und ergänzende Finanzierungsmodelle in der Gemeinschaft der Landeskirchen geprüft und dann auch mit den anderen Religionsgemeinschaften diskutiert werden, die Kirchensteuer erheben. Im Zusammenspiel einer verbesserten Kommunikation und einer gezielten Begleitung in biographischen Umbruchphasen kann die Verbundenheit junger Erwachsener mit der Kirche gestärkt werden.